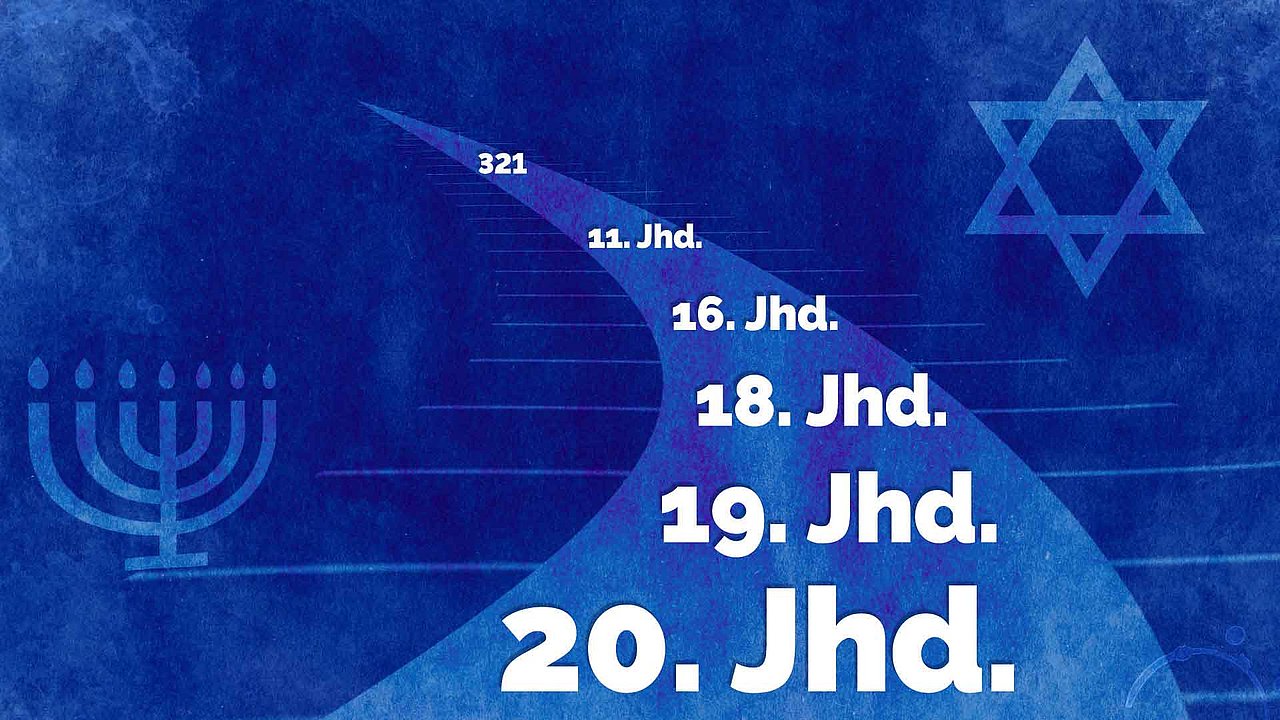David Rosenberg steht am 7. Oktober 2023 am Flughafen München. Er ist Teil einer Reisegruppe. Ihr Ziel: Israel. Doch früh am Morgen schon sieht er im Hotelzimmer schreckliche Bilder über den Fernseher flimmern. „Wir fliegen heute nicht mehr“, sagt er in einer Vorahnung zu seinem Zimmergenossen. „Sei nicht so pessimistisch“, entgegnet der.
Doch David Rosenberg ist sich seiner Sache sicher. Er war bereits unzählige Male in Israel, dem Land, in dem seine Mutter geboren ist. „Ich kann mich aus meiner Jugend an die Intifada erinnern und den Terror. Aber nicht in solch einem Ausmaß, dass Terroristen auf Jeeps in israelischen Kibbuzim herumfahren und Menschen umbringen.“ Das sagt er seinem Mitfahrer.
Trauma nach dem 7. Oktober
Handynachrichten trudeln bei ihm ein: „Komm nicht nach Israel, jetzt ist grad kein guter Zeitpunkt“, warnen Familienmitglieder und Freunde. Kurz darauf werden alle Flüge nach Israel storniert. Die Gruppe fährt kurzerhand an den nahen Tegernsee. „Ich war dankbar, dass ich die Gruppe um mich herum hatte, die konnten mich ein bisschen auffangen“, erinnert sich Rosenberg.
Ich wäre depressiv geworden mit den ganzen Nachrichten.
Viele jüdische Menschen hätten ein Trauma vom 7. Oktober, sagt David Rosenberg. Er lebt im südpfälzischen Rülzheim, einem 2.000-Einwohner-Ort. Jeder Jude, jede Jüdin könne sagen, wo er oder sie an diesem Tag war. Und auch ihn hätten einige Tage nach dem Tegernsee die Ereignisse noch einmal eingeholt.
Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen
Seine Familie stammt aus Ashkelon, nicht weit weg von Gaza. Sie erleben den Raketenbeschuss. „Wir konnte sich die Hamas so ein Raketenarsenal aufbauen?“, fragt sich David Rosenberg. „Wenn man sich überlegt, wie viel Geld in die Luft geschossen wurde, um andere Menschen zu töten und zu verletzen. Was hätte man davon für eine Infrastruktur für die Menschen aufbauen können?“
Den Holocaust überlebt
Israel ist ein Stück Heimat für ihn. In den 1970er Jahren zieht seine Großmutter mit ihren Töchtern aus Israel nach Deutschland. Dass er Jude ist, merkt David als kleiner Junge schnell, nicht nur, weil die Familie jüdische Feiertage begeht und regelmäßig nach Israel fährt. David Rosenbergs Urgroßmutter hat den Holocaust überlebt. Auch das ist ein großes Thema in der Familie.
Rosenberg bindet seine jüdische Identität niemandem auf die Nase - aber hält damit auf Nachfrage auch nicht hinter dem Berg. Er ist froh, wenn er antisemitische Vorurteile oder Verschwörungstheorien entkräften kann, etwa bei der Initiative „Meet a Jew“, die Juden an Schulen bringt. Er engagiert sich bei der Gedenkstätte für NS-Opfer in Neustadt.
Verschwörungstheorien auf TikTok
Und dann sind da die Begegnungen im Alltag. Die Besucherin im Möbelgeschäft, die sagt: „Ich dachte, ihr Juden seid ausgestorben.“ Oder der junge Auszubildende, der glaubte, Angehörige des Holocaust - überhaupt alle Juden in Deutschland – seien von der Steuer befreit. So habe er es auf TikTok gesehen, versichert er.
„Es gibt Menschen, die sich direkt bei mir entschuldigen wollten, wenn sie hören, dass ich Jude bin“, sagt David Rosenberg. Andere hätten Schwierigkeiten, das Wort Jude überhaupt in den Mund zu nehmen. Dass es auf Schulhöfen als Schimpfwort missbraucht werde, trage sicher seinen Teil dazu bei.
Der AfD nicht in die Karten spielen
Ja, an die Verbrechen der Nationalsozialisten zu erinnern, sei wichtig, sagt David Rosenberg. Dennoch fordert er eine Wende der Erinnerungskultur.
Gastkommentar: Ist unsere Erinnerungskultur noch zeitgemäß?
Die Perspektive all jener müsse in den Blick, die familiär keine Verbindung haben, in diese Zeit hinein. Gastarbeiterkinder, Muslime, Flüchtlinge. „Sonst wächst eine ganze Generation auf und sagt: Das ist ja ewig her, das ist uninteressant für mich.“ Und: Der Fokus müsse weg von den Juden als Opfer allein - hin zu einer lebendigen Erinnerungskultur. Sonst spiele man der AfD in die Karten.
Jüdische Studierende vernetzen
David Rosenberg arbeitet an seinem Master in Interkultureller Bildung, Migration und Mehrsprachigkeit. Vor zwei Jahren hat er den jüdischen Studierendenverband Reinland-Pfalz und Saarland, Hinenu, gegründet. Das hebräische Wort bedeutet auf deutsch „Wir sind“ oder „Hier sind wir“.
Als Studierender will er jüdische junge Menschen vernetzen. „Gerade in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz, wo man sich manchmal fragt, gibt es noch andere wie ich.“ Denn offensiv gehen die wenigsten jüdischen Jugendlichen mit ihrer Identität um, sagt Rosenberg. Viele wollten nicht reduziert werden auf ihr Jüdischsein.
Kippa trägt er nicht mehr
Kippa trägt David Rosenberg nicht mehr. „Ich würde gern denken, dass man das in Rheinland-Pfalz noch machen kann, aber ich bin mir auch nicht zu 100 Prozent sicher, ob das eine sinnvolle Idee ist“, sagt er mit Blick auf den Anstieg antisemitischer Straftaten. Zuletzt hat er am Mainzer Bahnhof auf Rat eines Freundes die Kippa ausgezogen.
„Ich finde das traurig“, sagt er und zieht den Vergleich zu Ungarn. „Dort habe ich so viele Menschen rumlaufen sehen, mit Kippa. Und dort gibt es noch ein krasses jüdisches Leben.“ Koschere Restaurants, Geschäfte, etliche Synagogen.
Fotos vom 7. Oktober
Im Mai 2024 reist David Rosenberg bei einem Solidaritätsbesuch einer rheinland-pfälzischen Delegation zum ersten Mal nach dem Überfall der Hamas nach Israel. Die Gruppe schaut sich zerstörte Kibbuzim an, auch das Festivalgelände, wo am 7. Oktober 2023 so viele Menschen starben. Er bekommt auch Fotos der Gräueltaten gezeigt. „Danach ging es mir gar nicht gut.“
Inzwischen sind seit diesem Tag zwei Jahre vergangen. Dass der Konflikt so lange andauere, damit habe er damals nicht gerechnet, sagt er – auch wenn er wusste: Israel wird und muss darauf reagieren.
Wie kann der Krieg beendet werden? Diese Frage beschäftigt ihn. Die Geiseln herauszuholen, darauf sollte der Fokus liegen, betont er. „Es sind schon so viele Menschen gestorben, auf beiden Seiten. Der Blutzoll ist so hoch.“
Kritik an Israels Regierung erlaubt
Die israelische Regierung ernte mit ihrem Vorgehen in Gaza logischerweise Kritik, sagt er. „Aber irgendwas müssen sie ja tun, dass die Menschen in Gaza auch ohne die Hamas leben können.“ Den Gazastreifen dauerhaft zu besetzen, ist für ihn keine Lösung. Es brauche einen demokratischen Partner in der Region. Noch sei es zu früh, um zu spekulieren, ob dies etwa mit Syrien gelinge, sagt Rosenberg.
Man kann die israelische Regierung kritisieren.
Kritik, die am Ende nur in israelbezogenen Antisemitismus münde, sei aber nicht legitim. Etwa wenn Menschen sagten, dass es generell keinen jüdischen Staat geben sollte oder Israel nur existiere, um anderen etwas wegzunehmen.
Letztlich müsse er wie alle Juden dankbar sein, dass es einen israelischen Staat gibt, gerade mit Blick auf die rechtspopulistische Bewegung in Europa. „Niemand weiß, wie das Leben sein wird 2039 oder 2055“.